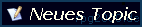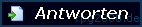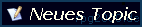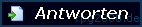Ich widme den folgenden Text Rianq, weil er ihn ganz sicher verstehen und zu würdigen wissen wird. ^_^ Sieh's als Abschiedsgeschenk. :3Die Herbürger Dürre
Es war im Dorf Herbürga, als eine große Dürre die Menschen plagte. Der Regen war dem Land fremdgegangen. Man wußte aber nicht, mit wem, wohin oder wie man ihn erreichen könnte. Daher schöpfte man Kraft und Wasser aus den umliegenden Flüssen und Seen. Doch mit der Zeit, von der bereits ein großes Stück vergangen war, seit die Dürre stattzufinden begonnen hatte, mit jener Zeit also wurden aus den Seen Pfützen und aus den Flüssen Rinnsale, aus der Geduld wurde Bangen und aus dem Glauben Verzweiflung. Die Vorräte erwarteten ihr Ende, ihre Besitzer befürchteten es. Irgendwann war es Montag und man traf sich, wie man das jeden Montag zu tun pflegte, auf dem großen Marktplatz und beriet sich und einander. Ein Dorfälterer hob an:
„Liebe Herbürger“, rief er, „die Dürre dauert nun schon etwas mehr als zwei Jahre an und hat sich seitdem nicht gebessert. Bisher konnten wir sie noch ertragen, aber nun wird es langsam Zeit uns zu überlegen, was wir dagegen tun können.“
„Es waren eigentlich zwei Jahre und neunundsechzig Tage“, sagte ein Anderer.
„Sollen wir machen, was Du sagst, nur weil Dein Haar grauer ist als meines?“, erregte sich ein Dritter.
„Eher weil er klüger ist als Du“, sprang ein Vierter dazwischen.
„Dich hat keiner gefragt“, erwiderte der Dritte.
„Liebe Herbürger!“ rief der Dorfältere. „So geht das doch nicht!“
„Das hast
Du nicht zu bestimmen!“
„Na, Du aber auch nicht.“
„Im Übrigen sind es zwei Jahre und achtundsechzig Tage.“
„Du bist ja verrückt.“
Ein großer Tumult brach los, und sehr bald schon war vergessen, weshalb man überhaupt auf dem großen Marktplatz stand und worum man stritt. Man wußte nur noch, daß man wieder aufhörte, weil man sich am nächsten Montag erneut versammelte.
„Liebe Herbürger,“ rief der Dorfältere, „die Dürre dauert nun schon sehr lange an hat sich seitdem nicht gebessert. Bisher konnten wir sie noch ertragen, aber nun wäre es schön und günstig, wenn wir uns gemeinsam eine Lösung überlegen könnten.“
„Ich glaube ja, daß die anderen Dörfer einfach schöner sind. Der Regen will hier nicht fallen, er findet's langweilig.“
„Den anderen Dörfern geht es doch ganz ähnlich. Ich war letztens erst da.“
„Ich habe Verwandte dort, die das sagen das auch.“
„Die wollen Dich doch nur fernhalten, weil sie Dich nicht ausstehen können.“
„Im Gegensatz zu Deiner Verwandtschaft redet seine wenigstens noch mit ihm.“
„Liebe Herbürger! So geht das nun wirklich nicht!“
„Dann gehe eben ich!“
So verging noch eine Woche. Viele Herbürger verließen das Dorf um andernorts zu leben. Natürlich war nicht sicher, daß die Dürre nicht auch dort bereits Einzug gehalten hatte, doch sie sahen sich genötigt, dem Problem zumindest zu entkommen, wenn man es schon nicht lösen wollte. Doch wie diese aus Angst vor dem Bekannten gingen, blieben jene aus Angst vor dem Unbekannten. Am folgenden Montag kamen die Übrigen ein weiteres Mal auf dem Marktplatz zusammen.
„Liebe Herbürger“, rief der Dorfältere, „die Dürre dauert nun schon viel zu lange an und wird immer unerträglicher. Bisher konnten wir sie noch ertragen, aber mittlerweile macht sie uns allen zu schaffen. Bitte seht doch ein, daß wir etwas unternehmen müssen, wenn wir nicht an ihr zugrunde gehen wollen.“
Verlegenes Gemurmel folgte dem eindringlichen Aufruf des Dorfälteren. Niemand wußte so recht, was man gegen eine Dürre tun konnte, wenn sie nicht von selbst wieder verschwand. Nur hin und wieder wurden Stimmen laut, damit überhaupt irgendwelche Stimmen laut wurden.
„Man könnte die Ursache der Dürre ergründen“, rief einer.
„Man könnte Anlagen bauen um Wasser zu sammeln und zu speichern“, rief ein Zweiter.
„Man könnte den Regen bitten, wieder in unser Dorf zurückzukehren.“
„Man könnte die Häuser mit dem Keller nach oben bauen und dem Rest in der Erde.“
Solche und weitere Vorschläge unterbreiteten die Herbürger den Herbürgern. Irgendwann wurde es still und man blickte erwartungsvoll auf den Dorfälteren, der in tiefes Schweigen versunken war. Stunden scheinende Minuten später hob er den Kopf und sprach:
„Wir müssen den Zauberer fragen.“
Auf das überraschte Schweigen folgten überraschtes Raunen und überraschtes Rufen. Der Zauberer war, so wußte man, der Gründer des Dorfes Herbürga und sehr alt und weise. Aber er war, auch so wußte man, schon lange nicht mehr im Dorf gesichtet worden. Nur wenige Herbürger gab es, die ihm dienten und die so Zutritt hatten zu seinem Turm. Von manchen wußte man es gar nicht. Von anderen wußte man es, aber auch sie wußten nicht, wo sich der Zauberer aufhielt. Von anderen wußte man es ebenso, doch sie hatten das Dorf bereits verlassen. Der Zauberer, so wußte man, war praktisch unerreichbar.
„Wir können den Zauberer nicht fragen“, sagte dann einer, „denn wir wissen nicht, wie. Der große Turm schluckt Briefe als würde er sie atmen, aber heraus kommt nichts dabei. Ich würde selbst hingehen, aber ich habe keinen Schlüssel.“
„Ich auch nicht“, schloß ein Chor.
Wieder versank der Dorfältere in Schweigen.
„Dann singen wir dem Wind“, sprach er schließlich. Nur wußte niemand recht, was das heißt, also erzählte der Dorfältere das Märchen vom Mädchen und der Nachtigall. „Eine Nachtigall, die hoch im Wipfel eines Baumes saß, sang Tag und Nacht für ein junges Mädchen, das er liebte. So schön sang sie, daß das Mädchen auch das Tier liebte, und es sang ein Lied zurück. Doch das Lied erreichte den Vogel in seinem hohen Wipfel nicht, und weil er daher annahm, daß das Mädchen seine Liebe nicht erwiderte, wurde er sehr krank. Als er vor Liebeskummer zu singen aufhörte, wurde das Mädchen sehr traurig und weinte helle Tränen. Der Wind, der das Mädchen ebenfalls liebte, jedoch nicht singen konnte wie die Nachtigall, wollte das Mädchen nicht weinen sehen und flüsterte ihr ins Ohr, daß sie ihm ihr Lied singen möge und er trage es zur Nachtigall hinauf. Da freute sich das Mädchen und gab dem Wind ihr Lied und einen Kuß. Der Wind, welcher ein ehrenvoller Wind war und auch einfach mit dem Lied und dem Kuß fort hätte wehen können, trug beides wie versprochen zu der Nachtigall hinauf. Als diese das Lied hörte und den Hauch des Kusses spürte, genas sie im Augenblick und zwitscherte vergnügt zu dem Mädchen hinunter.“
Nachdem der Dorfältere zu sprechen aufgehört hatte, verharrten die Herbürger in Schweigen. Schließlich fragte jemand:
„Hätte der Vogel nicht einfach runter fliegen können?“
„Ich finde, der Wind kommt da besser weg.“
„Wieso singt ein Vogel lauter als ein Mensch?“
„Ist die Nachtigall eigentlich weiblich? Das wäre ja obszön!“
„Liebe Herbürger!“, rief der Dorfältere. „Ihr glaubt wieder mal alles und versteht nur die Hälfte. Die Geschichte ist nur ein Gleichnis.“
„Aber wir sind doch keine kleinen Mädchen!“
„Und der Zauberer ist kein Vogel.“
„Und wer ist der Wind?“
„Der Zauberer ist jedenfalls kein Vogel.“
„Na ja, wissen wir's?“
„Und wer ist der Wind?“
„Liebe Herbürger!“, rief der Dorfältere. „Darum geht es in der Geschichte doch gar nicht. Ich wollte nur sagen, daß wir den Wind fragen müssen.“
„Warum hast Du das nicht einfach gesagt?“
„Blödes Märchen.“
„Wer ist denn jetzt der Wind?“
„Liebe Herbürger! Ihr solltet euch nur fragen, wer der Wind ist.“
„Das hab' ich doch -“
„Außerdem finde ich das Märchen dafür, daß es mir gerade eingefallen ist, ziemlich gut.“
Daraufhin nickten alle anerkennend und murmelten ihre Zustimmung. Trotzdem wußten sie immer noch nicht, wer mit dem Wind gemeint war.
„Der Zauberer“, begann der Dorfältere, „hat, wie ihr wißt, neben seinen Dienern auch einen Gesellen. Dieser ist es auch, der den Zauberer in seiner Abwesenheit vertritt. Der Geselle hat alle Schlüssel zum großen Turm und kennt den Zauberer besser als jeder von uns. Ihn müssen wir fragen.“
Viele Achsos und Naklars schwirrten umher. Einige freuten sich vor lauter Erleichterung angesichts dieser Idee. Andere fanden das Märchen immer noch unnötig und blöd. Einer wußte immer noch nicht, wer der Wind ist.
„Ich schicke einen Brief an den Delegierten“, sprach der Dorfältere, „denn er ist ein guter Freund von mir und wird uns gewiß helfen. Treffen wir uns nächste Woche wieder hier, um das Weitere zu beraten.“
Die Tage gingen, die Dürre blieb. Immer erdrückender wurde die schwüle Hitze, immer stärker der Durst. Immer weniger wurde das Wasser, immer größer hingegen die Zahl der fliehenden Herbürger, die nicht an die Idee des Dorfälteren glaubten, und auch nicht an den Gesellen des Zauberers, und auch nicht an ein plötzliches Ende der Dürre. Dennoch fand man sich am nächsten Montag wieder auf dem Marktplatz ein.
„Liebe Herbürger“, rief der Dorfältere, „ich habe den Gesellen des Zauberers um Hilfe ersucht und ihn gebeten, heute hier zu sprechen, damit wir alsbald von der Dürre befreit sein mögen.“
Einige klatschten, wenige jubelten. Der Geselle trat vor.
„Werte Herbürger“, rief er, „ich habe euren Brief erhalten, gelesen, verstanden und fachgerecht archiviert. Gerne möchte ich euch helfen, denn die Dürre betrifft uns alle und damit auch mich. Nicht länger kann ich tatenlos zusehen, wie mein Volk, das heißt das Volk des verehrten Zauberers, so lange so schwere Not leiden muß. Apropos leiden: Leider weiß ich auch nicht, wo der Zauberer sich befindet. Ich selbst habe ihn schon lange Zeit nicht mehr gesehen und keiner meiner Briefe an ihn wurde beantwortet.“
„Aber ist er denn nicht im Schloß?“, fragte ein Besorgter.
„Wenn er es ist, dann in seinen Privatgemächern. Dazu fehlen mir jedoch gleichermaßen Zutritt und Schlüssel.“
„Habt Ihr denn nicht alle Schlüssel zum großen Turm? Laßt uns doch hinein, dann können wir den Zauberer persönlich fragen“, meinte ein Hoffnungsvoller.
„Ich besitze nur die Schlüssel zum Verwaltungsteil des Schlosses, nicht jedoch zu den persönlichen Räumlichkeiten des Zauberers. Hineinlassen kann ich euch leider auch nicht, das verbietet das Gesetz.“
„Hat nicht der Zauberer das Gesetz gemacht?“, fragte ein Neugieriger.
„Schon.“
„Und seid Ihr nicht der Vertreter des Zauberers?“
„Schon.“
„Könnt ihr dann nicht auch das Gesetz machen, es also ändern?“
„Schon. Aber auch das wäre gegen das Gesetz.“
Ein Unflätiger wurde laut.
„Werte Herbürger“, rief der Geselle, „ich verstehe ja eure Bestürzung und möchte euch helfen, denn ihr betrefft uns alle und damit auch mich. Aber ich kann euch nicht in den Turm lassen, daher müßt ihr mir glauben, daß der Zauberer nicht dort ist, wo er mir begegnen konnte. Vielleicht ist er auch auswärts, ich weiß es nicht. Um ihn von der Not seines Volkes zu unterrichten, schlage ich ein Leuchtfeuer vor. Es muß so groß sein, daß es noch weithin sichtbar ist, und so lange brennen, daß man es nicht verpassen kann. Ob sich der Zauberer nun im Turm aufhält oder sonst wo: Wenn er das Leuchtfeuer sieht, wird er uns zu Hilfe eilen.“
Einige jubelten, viele klatschten. Einer fragte:
„In welcher Weise wird der Zauberer uns überhaupt helfen?“
„Nun, zuerst einmal ist er ein Zauberer“, sagte der Geselle. „Das heißt schon was. Außerdem wurde der große Turm, wie ihr sicher wißt, auf einer Quelle erbaut, der man magische Eigenschaften nachsagt. Das Wasser daraus soll Wunden heilen und nach mancherlei Gerücht sogar Tote wiedererwecken können. Ein einziger Tropfen soll genügen, einem Verdursteten frische Kraft zu schenken. Manchmal heißt es, daß ein regelmäßiges Bad darin den Körper verjünge. Ob das stimmt, weiß wohl nur der Zauberer selbst. Aber auch so kann das Wasser uns über die Dürre helfen.“
Erneutes Klatschen und Jubeln. Ein Anderer fragte:
„Was genau ist ein Leuchtfeuer? Leuchtet nicht jedes Feuer?“
„Technisch gesehen nicht“, sagte der Geselle. „Bestenfalls glüht es. Für das Leuchtfeuer brauchen wir eine große Menge Holz und Öl. Besorgt auch Stoffe, die viel Rauch und Qualm erzeugen, wenn man sie verbrennt. Schafft Laub und Zweige herbei, daß es ja ruße.“
Diesmal klatschte und jubelte niemand. Ein Dritter fragte:
„Geselle, wir haben kein Holz mehr. Die Bäume sind gestorben, ihre Zweige zerstaubt und das Laub fort. Die Dürre hat auch den dicksten Stamm müde gemacht. Das wenige harte Gesträuch reicht kaum für die Blüte, noch weniger für ein großes Feuer. Wir haben kein Holz mehr, Geselle.“
Daraufhin hob der Geselle die Brauen und blickte sich um. „Eure Häuser sind Holz und eure Dächer Stroh. Zündet diese an. Wenn ein ganzes Dorf in Flammen steht, wird es selbst vom entferntesten Reich nicht unbemerkt bleiben.“
Der Gedanke entfachte den Eifer der Herbürger, und darauf entfachten auch die Fackeln und Scheite und Häuser und Dächer. Man warf alles in das Flammenmeer, dessen man entbehren konnte, den kleinsten Fetzen Stoff, die wertvollsten Tische und Stühle. Zufrieden betrachteten die Herbürger ihr Werk und schickten ihre verbliebene Hoffnung mit Ruß und Rauch in den Himmel. Man hatte zwar keine Unterkunft, aber was war das schon im Angesicht der nahenden Hilfe? Was sollte auch geschehen? Das Feuer würde die Nächte wärmen, wilde Tiere ängstigen, Räuber fernhalten und Fürsten alarmieren. Es würde zwar Tage dauern, vielleicht Wochen, bis fremde Hilfe eingetroffen wäre, doch sie würde eintreffen, wenn der Zauberer nicht schon vorher käme.
Doch der Zauberer kam nicht. Drei Tage und drei Nächte brannte das Feuer, bis es schließlich verhungerte. Auf der übrigen Glut bereitete man das Essen. Noch wartete man auf den Zauberer oder wen auch sonst, denn in drei Tagen, so sagte der Geselle, könne man nicht besonders weit kommen, besonders in einer Dürre wie dieser.
Auch am vierten und fünften Tage kehrten die entsandten Späher ohne Kunde zurück. Doch keine Kunde, so sagte der Geselle, sei auch keine schlechte Kunde, und man könne ja nicht erwarten, daß andere Dörfer sich ebenfalls selbst entzündeten, nur um zu zeigen, daß sie die Nachricht erhalten hätten. Niemand mit rechtem Verstand würde seine eigene Behausung niederbrennen, sagte der Geselle.
Am sechsten und siebten Tage schickte man noch Späher aus. Der Qualm hatte die Augen der Herbürger gereizt und ihre Sehkraft geschwächt, weshalb man befürchtete, vorbeiziehende Hilfe vielleicht nicht zu bemerken. In alle Richtungen gingen die Kundschafter, die so hießen, obwohl sie gar keine Kunde schafften. Der Unmut der letzten Wochen stieg erneut in den Herbürgern hoch, umso mehr als einige der Späher sich unversehens aus dem reichlich vorhandenen Staube machten und ihr Heil in der Flucht zu anderen Orten suchten. Da niemand, der aus Herbürga weg gegangen war, je wiederkehrte, mußten sie zweifelsohne einen besseren, dürreärmeren Lebensplatz gefunden haben, der sie sogar vergessen ließ, daß ihr Heimatdorf in mächtiger Flamme stand. Eine andere Erklärung als diese konnte es nicht geben: daß das Glück jenseits Herbürgas liegen mußte. Von denen, die nicht aus Herbürga flohen, dachte jeder dasselbe. Viele waren sie nicht mehr, aber aus ihrer Hoffnung war Ärger geworden, der sie immer weiter antrieb, damit sie irgendwann jemanden verantwortlich machen konnten, wie die Sache aus immer ausgehen sollte. So geschlagen und gezeichnet standen sie am Montag, dem achten Tage nach dem großen Feuer, knirschend und bebend auf dem Marktplatz.
„Werte Herbürger“, rief der Geselle.
„Liebe Herbürger“, rief der Dorfältere. „Die Dürre dauert immer noch an, und trotz des großen Feuers ist keine Hilfe gekommen. Wir sollten gemeinsam überlegen, wie wir jetzt vorgehen.“
„Ich sag euch, wie wir jetzt vorgehen“, rief einer aus der lichten Menge, „wir gehen zum Turm und durchsuchen jeden Winkel nach dieser Quelle. Entweder ist der Zauberer auch dort oder er hat uns vergessen.“
„Er muß nicht fort sein um uns vergessen zu haben“, meinte ein Anderer.
„Wir sollten dennoch nach der Quelle suchen. Wir haben keine Häuser, in die wir zurückkehren können, keine Freunde, die uns helfen, kein Wasser und Brot. Was wir haben, sind Hunger, Durst und Schweiß.“
„Und jede Menge Staub“, nickte ein Dritter.
„Und jede Menge Staub“, nickte der Zweite.
„Werte Herbürger“, rief der Geselle, „wie ich euch bereits sagte, ist es gegen das Gesetz, nichtautorisierte Personen in den Turm zu führen, von den Privatgemächern des Zauberers gänzlich zu schweigen. Wenn ihr das Gesetz übertretet, werdet ihr mit Strafen rechnen müssen.“
„Und wo wollt Ihr uns einsperren?“
„Im Turm natürlich.“
„Sind wir dann autorisiert?“
„Natürlich nicht. Deshalb wärt ihr in dauerhafter Straftat und müßtet ewig dort bleiben.“
Die Herbürger sahen einander verwundert an. Mit solchen Kräften hatten sie nicht gerechnet. Stunden scheinende Minuten raunte es durch sie hindurch.
„Jedenfalls gehe ich jetzt in den Turm“, sagte der Erste. „Haltet mich auf oder kommt mit. So oder so.“
„Werte Herbürger!“, rief der Geselle, „so geht das doch nicht!“
Doch keiner außer ihm und dem Dorfälteren vernahm seine Worte. Die aufgebrachten Herbürger schritten dem Turm entgegen, dem Gebäude, in dem ihre restlichen Hoffnungskleckse vermoderten, während man ihnen verbot, sie zu finden. Wütend, weil der Zauberer sie verlassen hatte; wütend, weil sie ihn nicht schon früher verlassen haben; wütend, weil auch ihre Hoffnung sie verlassen hat. Sie hatten gehofft, gebetet und geglaubt, und geantwortet worden war ihnen mit demselben Schweigen, das sie überhaupt erst so weit gebracht hatte. Sie erklommen die Zinnen des prächtigen Gebäudes, hämmerten an Türen und Fenster, zerstören, so viel so können, von dem Turm, das gar nichts dafür konnte, und wollten bald mehr den Zauberer selbst als seine Quelle finden. Schließlich aber stießen sie auf beides. Durch ein prunkvoll ausstaffiertes Schlafgemach plätscherte in unschuldiger Ruhe ein kleiner, aber entschlossener Strom freudig glitzernden Wassers. Die kühle, feuchte Luft legte sich über Wut und Ärger der Herbürger, glättete ihre Fäuste zu zitternden Schüsselchen, mit denen sie sogleich das labende Naß über Kopf und Nacken strömen, in ihre vertrockneten Münder laufen oder zur bloßen Freude einfach zurückfallen ließen, um sich an dem Geräusch der Tropfen zu erquicken. Da plötzlich rief der Dorfältere:
„Liebe Herbürger! Der ehrenwerte Zauberer ist tot!“
Jeder wandte sich nach der Gestalt um, die über einer mit wertvollstem Geschirr gedeckten und mit verfaulten Essensresten belegten Tafel zusammengesunken war. Der Kopf ruhte neben einem goldverzierten Teller, und auf ihm ruhte eine goldverzierte Krone. Der Mund stand geöffnet und entblößte die mit Schimmel und Fäulnis benetzten Zähne. In der offenen Hand daneben lag, gleichermaßen zersetzt, was der Zauberer zum Zeitpunkt seines Todes vermutlich gegessen hatte.
„Wurde er angegriffen?“, fragte einer.
„Nirgendwo ist Blut und der Körper ist sonst unversehrt“, stellte der Dorfältere fest.
„Dann war es Gift?“, fragte ein Zweiter. Der Geselle, der sich, bleich geworden, auf einen Stuhl gesetzt hatte, schüttelte langsam mit starrem Blick den Kopf.
„Er hat sein Essen stets selbst gemacht“, sprach er leise.
„Aber er hatte doch alles“, bemerkte der Erste, „er kann doch nicht verhungert sein.“
„Nein“, sagte der Geselle. „Er ist vor Durst gestorben.“
Ratlose Blicke trafen den Gesellen. Er hörte die Frage, die niemand stellte. Dann stand er auf, zuckte mit den Schultern und sagte mit einem Blick auf den Zauberer:
„Er hat es wohl einfach vergessen.“